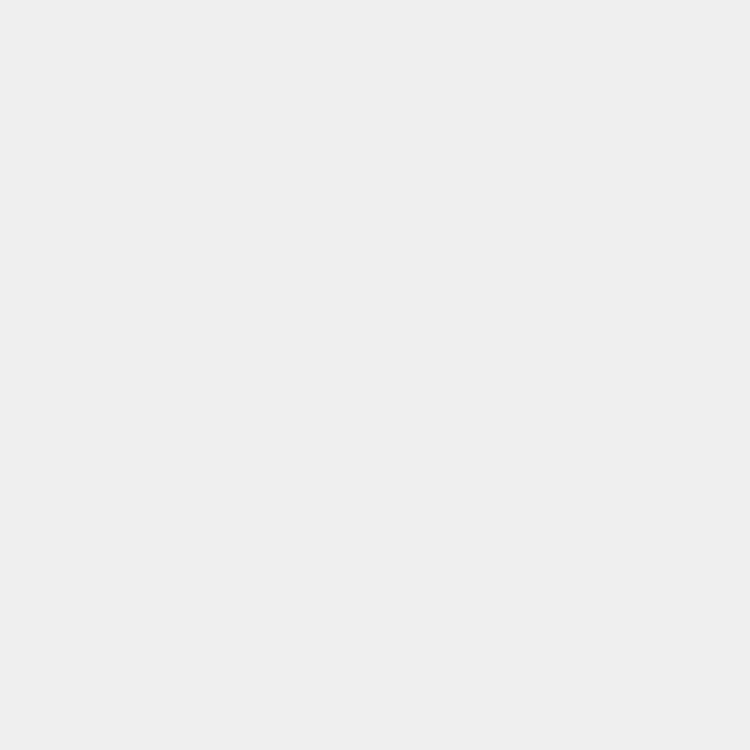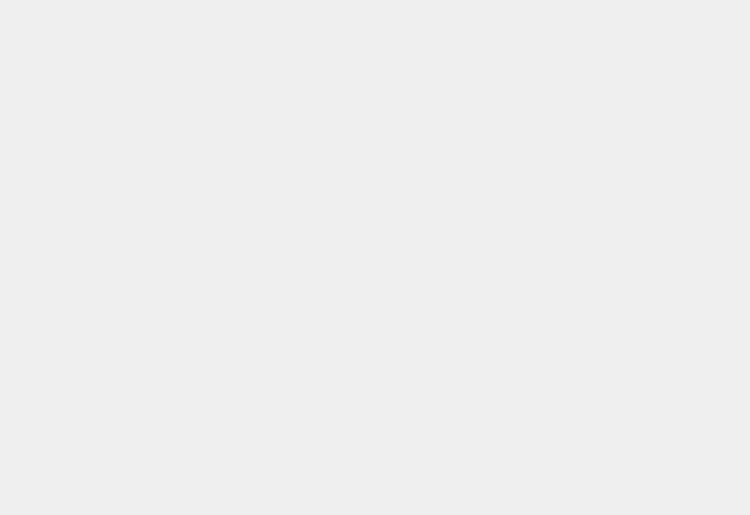Gustav Klimt, Fakultätsbild Medizin. Ausschnitt mit der Hygieia, um 1907 © Privatbesitz
Wiener Geschichten - Leopold Museum Blog
DER SALON ZUCKERKANDL
Keimzelle der Inspiration
Als Bezeichnung für ein Organ, eine Faszie und einen Zwischenknochen ging der Name „Zuckerkandl“ in die Anatomiebücher ein. Ihrem Entdecker, dem Wiener Mediziner und Universitätsprofessor Emil Zuckerkandl (1849-1910), schwebte eine fruchtbare Wechselwirkung zwischen Kultur und Wissenschaft vor:
„Ein Forscher, ein Wissenschaftler, wird niemals vollkommen produktiv sein, wenn nicht auch ein künstlerisches Element in ihm lebt.“
Gemeinsam mit seiner Frau – der Journalistin, Übersetzerin, Kunstkritikerin sowie Diplomatin Berta Zuckerkandl (1864-1945) – bewohnte er eine Villa in der Döblinger Nußwaldgasse.
Am Jour fixe vereinte Berta Zuckerkandl dort in ihrem Salon Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Kunst und Kultur in anregendem Austausch. Zu ihren Stammgästen zählten der Schauspieler Alexander Girardi, Literaten wie Egon Fridell und Hermann Bahr, der Sezessionist Gustav Klimt, die Künstler*innen der Wiener Werkstätte, der Mediziner und spätere Stadtrat Julius Tandler, der Theaterdirektor Max Burckhardt und viele mehr. Man philosophierte, rezitierte, echauffierte sich, lauschte Komponisten wie Gustav Mahler oder Arnold Schönberg beim Klavierspiel und ließ sich bei Séancen verzaubern. 1908 wurde dieser Raum zum Austragungsort eines Empfangs anlässlich einer Tagung der europäischen Akademien der Wissenschaften in Wien. In ihren Memoiren notierte Berta Zuckerkandl hierzu:
„Es war ein Anblick, wie ihn nur noch die letzte Phase des Weltfriedens bieten konnte. Aus allen Zentren der Wissenschaft waren Gelehrte gekommen: Franzosen, unter ihnen der Mathematiker Poincaré, Spanier, Deutsche, Skandinavier, Italiener, Engländer.“
Der angehende Schriftsteller Arthur Schnitzler erprobte wiederum in den illustren Kreisen um Zuckerkandl erste Auszüge aus neu verfassten Theaterstücken und begegnete in Berta Zuckerkandls Salon erstmals dem großen Regisseur Max Reinhardt. Berta und Emil hatten Schnitzler bei einem Besuch in dessen Elternhaus kennengelernt. An jenem Abend herrschte allerdings gedrückte Stimmung, da er seinem Vater bloß eine Stunde vor Ankunft der Gäste offenbart hatte, nicht in dessen Fußstapfen als Laryngologe treten zu wollen, sondern Schriftsteller zu werden. Vielen Besuchen*innen, die im Gegensatz zu Schnitzler keinen Karrierewechsel wagten, boten die Gespräche im Salon Zuckerkandl wiederum eine heißersehnte Möglichkeit, sich über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinwegzusetzen. Die Gastgeberin erinnerte sich an eine intensive Debatte über Musik und Theater zwischen einigen Kollegen ihres Mannes:
„Sobald man sich über irgendeine Diagnose verständigt hatte, stürzte man sich sogleich auf Themen dieser Art. Erst recht, wenn in den letzten Tagen im Burgtheater Ibsen oder Schnitzler gespielt wurde; war doch das Theater Wiens brennendste Angelegenheit. Die Oper war diesen Ärzten ein Heiligtum.“
Die Inspiration verlief jedoch keineswegs nur einseitig. Emil Zuckerkandls Kindheitstraum, ein Violinvirtuose zu werden, ging nicht in Erfüllung. In seinen medizinischen Vorträgen lebte sein kreativer Schaffensdrang aber fort. Eines Abends war der Saal im Anatomischen Institut in der Währingerstraße dicht gedrängt mit Maler*innen, Schriftsteller*innen und Musiker*innen gefüllt. In einem schwarzen Talar trat er ans Pult und leitete seinen Vortrag ein mit den Worten:
„Ich will Ihnen, meine Damen und Herren, Kunstformen in der Natur vorführen. Sie werden mit Erstaunen wahrnehmen, dass die Natur Ihre künstlerische Fantasie weit übertrifft. […] Wohlausgeklügelte Färbungen von Gefäßen, von einem Stückchen Epidermis, einer Arterie, einem Blutstropfen, ein wenig Gehirnsubstanz – werden Sie alle in eine Märchenwelt versetzen.“
Im Publikum saß auch seine Frau, die in ihren verschriftlichten Erinnerungen festhielt, wie nach Verdunkelung des Raumes ein Projektor unwirkliche und mystische Gebilde auf die Leinwand warf. Sie fühlte sich versetzt in ein tropisches Dickicht, eingetaucht in schimmernde Unterwasserwelten und umgeben von surrealen Sternenbildern. Gustav Klimt war es, der den Anatomen um einen derartigen Vortrag gebeten hatte. In seinen monumentalen Fakultätsgemälden, in Danaë und in zahlreichen weiteren Werken zeichnet sich der tiefe Eindruck ab, welchen jener Abend hinterlassen hatte. Zellen und Gewebeformen hielten als Ornamente in die Malerei Einzug und auch die Entwerfer*innen aus der Wiener Werkstätte blieben vom Universum des mikroskopisch Kleinen nicht unbeeindruckt.
Beitrag von Regina Reisinger