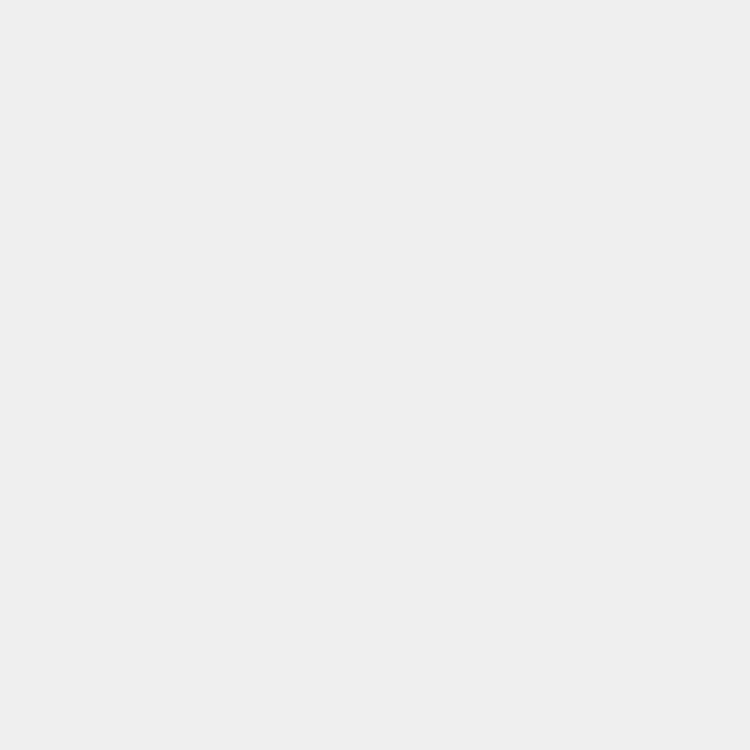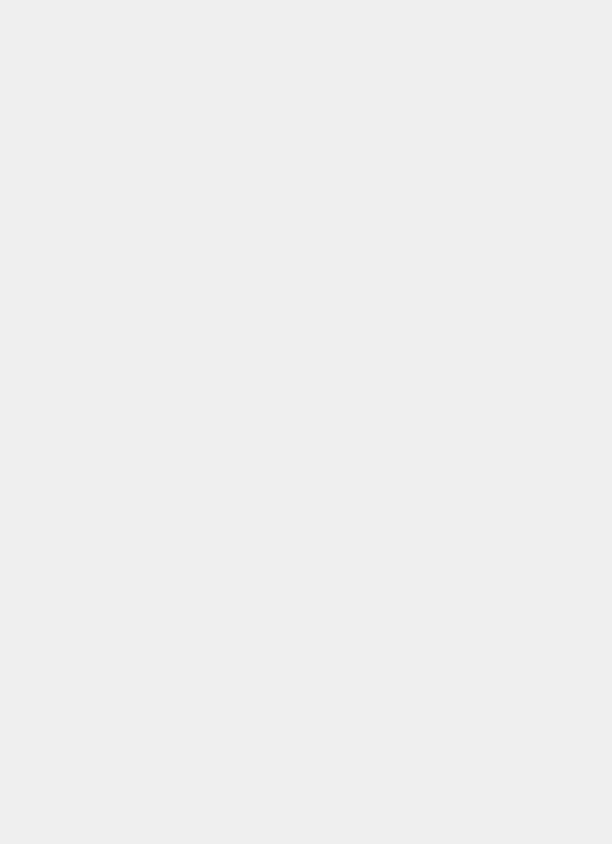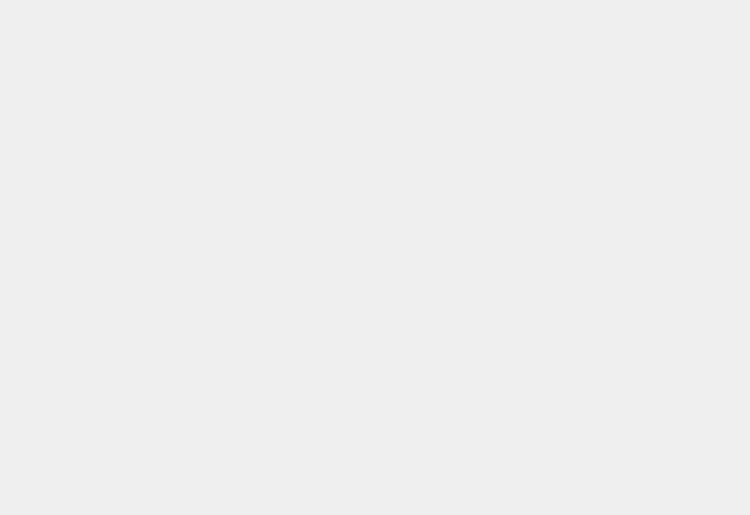EGON SCHIELE, »Blinde Mutter«, 1914 © Leopold Museum, Wien, Inv. 483
Wiener Geschichten - Leopold Museum Blog
Gebären und Nähren –
Elegie statt Ode
Das neue Mutterbild in der Moderne
Schaurig und verstörend: Wie ein mumienhaft mit fahl-ledriger Haut überzogener Totenschädel starrt das Antlitz der Mutter aus dem grünlich-gelben Schleier-Umhang. Eines der beiden Kinder ruht wie leblos aufgebahrt auf ihrem Schoß. Das zweite balanciert in scheinbar schwebender Haltung wie der neugeborene Heiland auf ihrem linken Knie. Beiden sind deformierte, wie gequetscht erscheinende Gesichtchen eingeschrieben. Selbst dem ockergelben Hintergrund haftet etwas Düsteres und Morbides an.
Eine Pietà oder doch die selig-sanfte Muttergottes, die der Welt den neugeborenen Heiland präsentiert? Namenlose Trauer und grenzenloses Leid einer Mutter, die ihren zu Tode gefolterten Sohn in Händen hält, oder stolzes Mutterglück? Inwieweit nahm Egon Schiele (1890–1918) im Gemälde Mutter mit zwei Kindern von 1915 auf jene archetypischen Mutterdarstellungen Bezug, die sich von der altägyptischen Isis und Osiris bis zur Madonna des Christentums einem frenetischen Mutterbild verpflichtet fühlten? Eine Frau in freudiger Hingabe, die der Welt ein Kind – ein ganz besonderes, ein göttliches, den Heiland – geschenkt hat? Und nun eine elegische Version eines alten Themas?
Bereits ein Jahr zuvor hat der junge Maler mit Blinde Mutter eines der zentralsten Themen der Weltkunstgeschichte mit schonungsloser Präzision in Form gegossen: Nicht die fürsorglich-hingebungsvolle, die sanfte, liebende, schwelgende Mutter zeigt Schiele. Nicht das dichte Beziehungsgeflecht zwischen der Frau und den bedürftigen, verletzlichen und liebesabhängigen Geschöpfen, die sie hervorgebracht hat, steht im Vordergrund; vielmehr die Unfähigkeit, sich umfassend ihrer Kinder anzunehmen, ihnen Zärtlichkeit und Wärme angedeihen zu lassen.
Das Gemälde Tote Mutter I von 1910 ist die vielleicht radikalere Version. Es scheint, als würde im leichenblassen Leib der Verstorbenen das Kind noch im Fruchtwasser träumerisch selig dahintreiben. Mit dem ersten Atemzug beginnt gleichzeitig der Abschied vom Leben. Nicht der banale Alltag, sondern Geburt und Tod als Grenzerfahrungen sind es, die den jungen Maler fesseln. Auch die Schwangerschaft: Zwar gilt die Frau im Selbstverständnis einer heteronormativen Gesellschaft als Gebärende und Nährende, doch die Darstellung des weiblichen Leibes in anderen Umständen ist in der Donaumonarchie tabubehaftet. Der Frauenkörper darf gezeigt werden – auch so wie Gott ihn geschaffen hat –, aber bloß nicht jener, in dem die Frucht des Leibes heranwächst. Gustav Klimt (1862–1918) bricht dieses Tabu mannigfach. Als Avantgardist, der sich konsequent mit dem Faszinosum des Weiblichen befasst, variiert er motivisch den schwangeren Frauenleib.
Wissenschaftliche Erkenntnisse verändern das Selbstverständnis der Zeit. Ohne den neuen, introspektiven Blick auf das Menschsein, den der Neurologe und Mediziner Sigmund Freud eröffnet hat, wären die radikalen Schritte dieser Avantgardisten kaum denkbar gewesen.
Ferdinand Georg Waldmüller, Heimkehrende Mutter mit Kindern, 1863 © Leopold Museum, Wien, Inv. 636
Tiefe Einblicke in ein noch gänzlich anderes Bild der Mutter ein halbes Jahrhundert zuvor erlaubt uns Ferdinand Georg Waldmüller (1793–1865). In seinem Gemälde von 1863 werden wir – noch ganz den Idealen der Biedermeierzeit verhaftet – mit einer zärtlichen, behütenden, sich aufopfernden Mutter aus bäuerlichem Milieu und ihren rotbackigen Kindern konfrontiert. Waldmüller zeigt die Heimkehrende in ihrer zentralen Rolle als Reproduzierende, die sich in Sanftmut, herzlicher Fürsorge oder wohlmeinender Strenge ergeht. Im Fokus steht das zarte und doch so intensive Band zwischen Mutter und Kindern.
Welch krasser Bruch: Egon Schiele taucht in seiner Zeichnung von 1910 den geschwollenen Bauch einer Hochschwangeren in morbides Grün. Das Neugeborene in violett-purpurnen Aquarelltönen seiner kolorierten Blätter von 1910 mag in starrem Spasmus seinen ersten Schrei noch nicht von sich gegeben haben. Oder ist es gar tot geboren? Brutal und direkt sind wir dem elementaren Geschehen einer Geburt gegenübergestellt. Keinen romantisierenden, sondern einen wahrhaftigen Blick richtet Egon Schiele auf den biologischen Vorgang. Durch den befreundeten Gynäkologen Erwin von Graff hat Schiele Anfang 1910 die Möglichkeit bekommen, sich an der 2. Wiener Frauenklinik mit den Gebärenden auf den Untersuchungstischen und Neugeborenen zu konfrontieren. Durch dieses seltene Privileg erlangt der 20-jährige Künstler eine unverstellte Perspektive auf das Elementare, das Wahrhaftige. Er macht sichtbar, was nicht gezeigt werden darf. Die Mutter bekommt eine neue Rolle und Bedeutsamkeit.
Beitrag von Markus Hübl