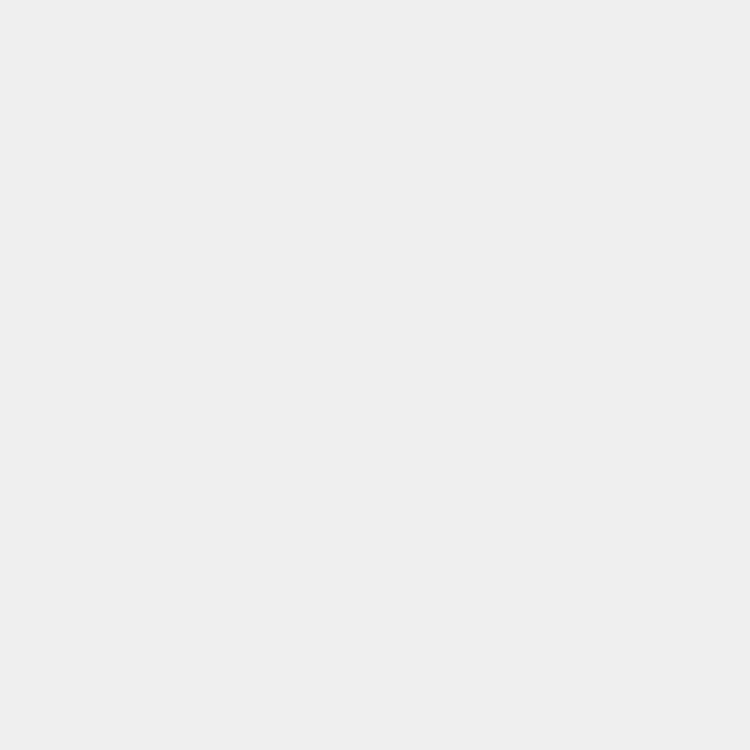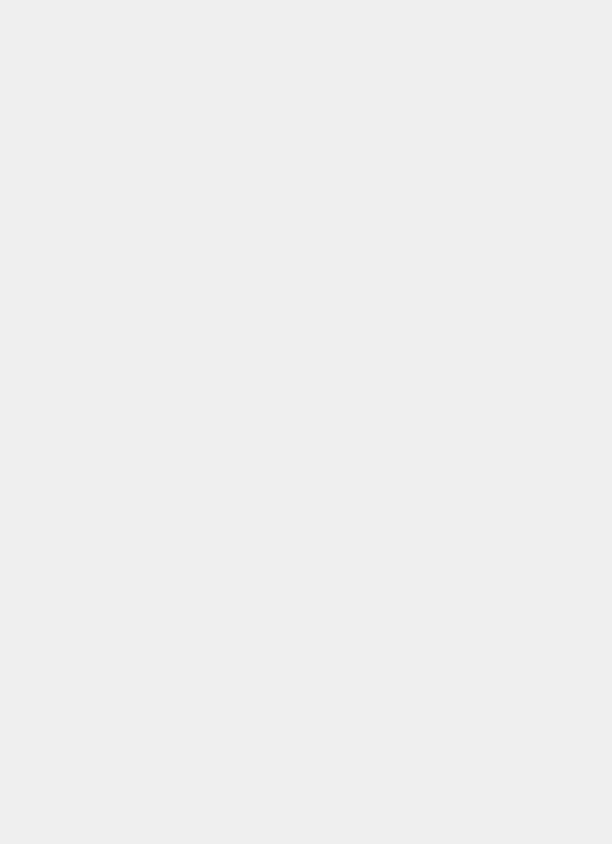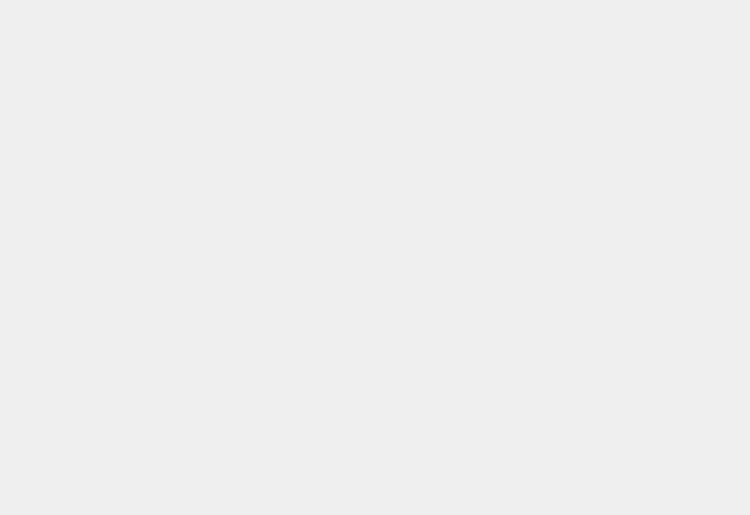Gustav Klimt, Tod und Leben, 1918 © Leopold Museum, Wien
Wiener Geschichten
Im Tod sind alle gleich?
Leopold Museum Blog
Unter der Erde beziehungsweise in der Asche, schrieb der römische Philosoph Seneca (lat.: aequat omnis cinis), sind alle gleich, doch schon seit vielen Jahrtausenden gestalten Menschen Grabstätten als individuelle und kollektive Gedenk- und Erinnerungsorte. Wie kann den geliebten oder bewunderten Personen gedacht werden? Was wünscht man ihnen im Jenseits? Und was erhoffen sich die Lebenden für ihre Trauer, ihr Erinnern und ihre Zeit, die sie am Friedhof verbringen? Die Friedhöfe zeugen somit nicht nur von den Toten, sondern auch von den lebendigen Gesellschaften, ihren Ansichten, Bedürfnissen und kulturellen Praktiken, durch die sie entstehen.
Der Wiener Zentralfriedhof beherbergt gegenwärtig auf seinen fast 2,5 Quadratkilometern rund 330.000 Grabstellen und wurde für über drei Millionen Menschen zur letzten Ruhestätte. Um das wiederkehrende Übel von Pest, Cholera und Typhus einzudämmen, verfügte Joseph II. (1741–1790) bereits Anfang der 1770er-Jahre die Verlegung fast aller urbanen Begräbnisstätten in die neu geschaffenen Friedhofsareale außerhalb des Linienwalls. Doch auch die Kapazitäten der fünf damals errichteten Friedhöfe, beispielsweise Sankt Marx, waren im rasant wachsenden Wien des 19. Jahrhunderts schnell erschöpft. Vor 160 Jahren beschloss der Wiener Gemeinderat deshalb den Bau des Zentralfriedhofs, der am 1. November 1874 eröffnet wurde und damals der größte Friedhof Europas war.
Egon Schiele, »Selbstseher« II (»Tod und Mann«), 1911 © Leopold Museum, Wien, Inv.Nr. 451
Als interkonfessioneller und kommunal betriebener Friedhof wurde er unter hitzigen Debatten der kirchlichen Verwaltung entzogen. Auch unter den Wiener*innen musste sich der Zentralfriedhof erst seine Beliebtheit verdienen. Vom Stadtzentrum lag er mit etwa neun Kilometern reichlich weit entfernt. Entlang der Simmeringer Hauptstraße war der Tod mehr Teil des Lebens, als es vielen lieb war, denn täglich kutschierten Pferdefuhrwerke bis zu 50 Verstorbene in die neue Totenmetropole. Es gab jedoch erfinderische Lösungsvorschläge: Wie bei einer Art Rohrpost sollten Leichen mit 27 km/h unterirdisch durch ein mit Druckluft betriebenes Antriebssystem in die Bestattungshalle gelangen. Leider scheiterte dieses Vorhaben am Mangel finanzieller Mittel. Erst ab 1918 wurden die Transporte auf die Straßenbahnlinie 71 verlegt.
Abgesehen von der Entfernung war jedoch auch die anfänglich karge und in Konstruktion befindliche Anlage für einen Besuch wenig einladend und erhielt den Beinamen „Centralschlachtfeld“. Baumaßnahmen wie ein repräsentativer Haupteingang und eine aufwändig gestaltete Begräbniskirche sowie die Einführung von kunstvollen Ehrengräbern änderten dies ab 1883. Durch Kunst verwandelte sich der Ort der Toten auch in einen Ort für Lebende. Die 1911 eingeweihte Jugendstilkirche zum heiligen Karl Borromäus, entworfen vom Architekten Max Hegele (1873–1945), zählt dabei zu den architektonischen Höhepunkten des Friedhofs. Aufgrund der kriegsbedingten Schäden von 1945 kann der Sternenhimmel in der Kuppel, bestehend aus 21.000 Mosaikteilen, die in Glas eingeschmolzenes Blattgold enthielten, heute jedoch nur als Nachbildung bewundert werden.
Das aufstrebende Bürgertum Wiens sehnte sich nach einer „schönen Leich“ – was keineswegs die verstorbene Person meinte, sondern den festlichen Bestattungsakt und eine prunkvolle Grabstätte. Dieser Ruf reichte so weit, dass verdienstvolle Persönlichkeiten zeremoniell in den Zentralfriedhof umgebettet wurden. So übersiedelte das Grab der Weltreisenden Ida Pfeiffer (1797–1858) ) im Zuge einer zweiten Bestattung von Sankt Marx in den Zentralfriedhof. Ihr Sterbejahr datiert somit noch vor dessen Eröffnung. Der Architekt Adolf Loos (1870–1933) entwarf ein schlichtes Grabkreuz für das Ehrengrab des befreundeten Schriftstellers Peter Altenberg (1859–1919) und verzichtete dabei auf Pomp und Verzierungen.
Die Beschäftigung mit dem Tod fand selbstverständlich auch außerhalb der Friedhofsmauern statt und spiegelt den Wandel gesellschaftlicher Bedürfnisse und Überzeugungen wider. Obwohl bereits 1873 in der Bevölkerung eine Zustimmung zur Feuerbestattung aufkeimte, wurde das erste Krematorium in Simmering erst 1922 gegen den Widerstand der katholischen Kirche eröffnet. Der Streit privater Bestattungsunternehmen um ihre künftige „Kundschaft“ reichte um 1900 so weit, dass der letzte Herzschlag gelegentlich schon an der Türschwelle abgewartet wurde. 1907 beendeten die sogenannten „Pompfinebrer“ und die Kommunalisierung des Gewerbes diesen Wettstreit.
Die Frage nach der Individualität des Todes beschäftigte auch die Künstler Gustav Klimt (1862–1918) und Egon Schiele (1890–1918): In Klimts Gemälde Tod und Leben überlegt der schief grinsende, universelle Tod, der alle gleichermaßen einholt, wen er als Nächste*n aus dem träumenden Zirkel der Lebenden reißen könnte. Die blasse Gestalt im Hintergrund von Schieles Gemälde Selbstseher II gleicht hingegen der Person vor ihr: Sie lässt sich als individueller Tod interpretieren, der jede*n persönlich ereilt.
Beitrag von Regina Reisinger