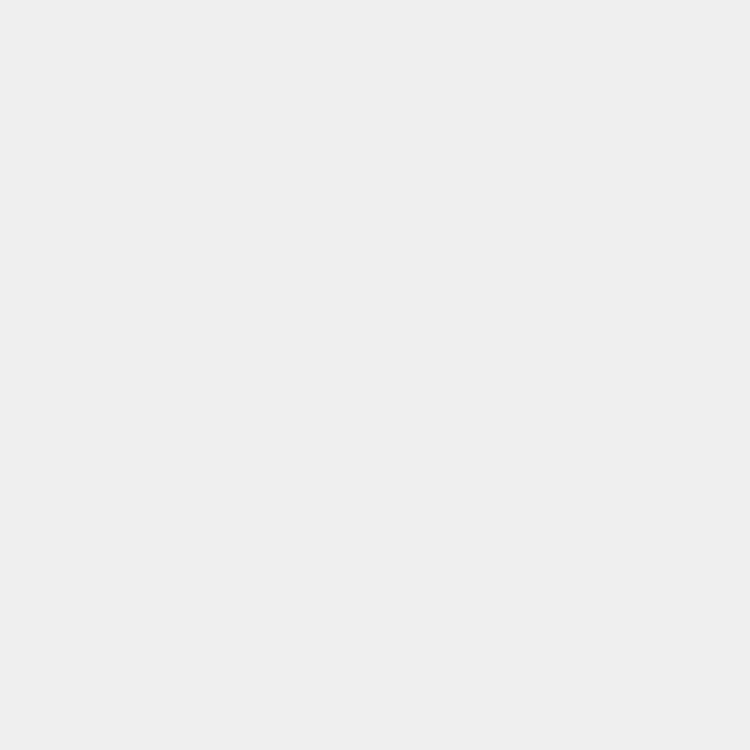Jakob Alt, Ballonfahrt über Wien (Blick auf Wien von Südwesten mit einem Ballon über der Stadt), 1847 © Wien Museum, Foto: Wien Museum
Wiener Geschichten - Leopold Museum Blog
BIEDERMAIERS NEUE SICHT
AUF DIE WELT
Bestürzung und Fassungslosigkeit bei den Pilgerinnen und Pilgern, die sich auf die anstrengende Wanderung nach Mariazell begeben haben: Entkräftet ist eine von ihnen zusammengebrochen. Im Schatten eines sonnenbeschienenen Felsens liegt nun die Bäuerin wie aufgebahrt da. Ein Fläschchen Wasser wird ihr gereicht, während die anderen Mitreisenden ihr Gebete und Anteilnahme zukommen lassen. Wie eine emotional packende Theaterszene entrollt sich vor unserem Auge das Drama aus dem wahren Leben. Das mit einem zinnoberroten Tuch und gekränztem Buchsbaumlaub und Rosen geschmückte Kruzifix, das von einem jungen Burschen gehalten wird, überragt die dicht versammelte Gruppe. Dahinter – zwischen schroffen Felsen, Wurzeln, blühenden Waldsträuchern und einer Schwarzkiefer – öffnet sich der Blick auf die glaubwürdig porträtierte Landschaft südlich von Wien. Bis an den Horizont lässt Ferdinand Georg Waldmüller unser Auge schweifen: Werden die Bauersleute es mit all ihren Wünschen bis nach Mariazell schaffen? Je länger wir das Bild betrachten, desto näher kommen wir ihren Emotionen, ihren Träumen. Zwischenmenschliche Verstrickungen ziehen uns ebenso in den Bann wie der Wiedererkennungswert der Landschaft. Es war die Erzherzogin Maria Theresia, die dereinst die Kiefernwälder am Rande der Metropole Wien hat pflanzen lassen, um der bedürftigen Landbevölkerung die Möglichkeit zu geben, auch in der Winterzeit Einnahmen als Pecher zu lukrieren.
Die in der Brillanz des Lichtes ausgeleuchteten Emotionen und die Buntfarbigkeit der adretten, sich in makelloser Akkuratesse darstellenden folkloristischen Gewänder der Menschen – das alles erzeugt eine Gesamtwirkung von scheinbarer Authentizität und Empathie! Wir werden emotional gepackt und wähnen uns mittendrin. Und dennoch: Sind die Gewänder der armen Reisenden nicht doch ein wenig zu gepflegt und fusselfrei? Ist ihre Zuwendung nicht gar etwas zu anrührend und zu liebenswürdig?
Der klare Blick und die Meisterhand sind es, die Glaubwürdigkeit erzeugen. Waldmüller lässt uns die trockene Erde, die Rinde, die Felsflechten und Blümchen förmlich riechen. Seine Kunst scheint regelrecht olfaktorisch wahrnehmbar. Er setzt Maßstäbe im Heranrücken der Realität und verleitet uns dazu, die Welt mit allen Sinnen einzusaugen. Wir fühlen mit den Gestalten mit und leben somit das Paradigma einer Gesellschaft, in welcher Empathie, Mitgefühl und Humanismus an Bedeutung gewinnen.
Viele der biedermeierlichen Genreszenen sind im bäuerlichen Milieu angesiedelt. Menschen, die bis vor kurzem noch nicht als bildwürdig erachtet worden sind, werden nun ins Licht und somit ganz nah an uns herangerückt. Die Gesellschaft ist in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einem tiefgreifenden Wandel unterworfen: Das Bürgertum erstarkt immer mehr. Gleichzeitig fürchtet das Kaiserhaus nichts mehr, als von den Ausläufern der Französischen Revolution hinweggefegt zu werden. Repression und Zensur unterdrücken die freie Meinungsäußerung und lähmen die Gesellschaft. Auch die Herzogtümer Europas stehen unter Paralyse: Napoleons Aggression ist kaum etwas entgegenzuhalten. Die Idee der Nation wird geboren: Wir, das Kollektiv, gegen die Gewalt des anderen. In den Verstrickungen der Napoleonischen Kriege werden plötzlich die bis dahin als nicht bedeutsam betrachteten „kleinen Leute“ wichtig. Sie sollen gegen die Truppen des Aggressors ins Feld ziehen.
Die Welt ist im Wandel. Technische Veränderungen prägen das Habsburgerreich: Eisengießereien und Glasindustrie in Böhmen verschlingen Unmengen an Holz. Verwüstete Landschaften sind das angsteinflößende Schreckgespenst. Um neue, schnellwüchsige Baumsorten zu besorgen, werden Expeditionen nach Südamerika ausgesandt. Die Lust am Fremden, der Exotismus greift um sich. Aber auch die Gier nach Unterhaltung, die in Kosmoramen bedient wird.
Wissenschaftlicher Entdeckergeist schärft den Blick nach innen und nach außen. Der alpine Raum mit seinen schroffen, bizarren Bergspitzen, den Schneemassen und den noch ausgedehnten Gletschern erregt ehrfurchtsvolle Aufmerksamkeit. Maler bilden gleichsam die Speerspitze der mutigen Expeditionen in diese unwirtlichen Gefilde und halten mit nie dagewesener Genauigkeit fest, was bis dahin als gefährlich galt. Der Lava speiende Vesuv in dramatisch zugespitzter nächtlicher Eruption landet als dekoratives Sujet im gepflegten Salon.
Perspektivenwechsel: Gottlieb Biedermaier ist der Inbegriff eines Spießbürgers, der sich aus der verunsichernden Welt zurückzieht und in die kleine Ödnis seines schmucklosen Häuschens mit biederem Gärtchen flieht. Urheber dieser Kunstfigur sollen der Jurist und Schriftsteller Ludwig Eichrodt sowie der Arzt Adolf Kußmaul sein. Ihren Namen erhielt sie in einer Parodie auf den Dorfschullehrer Samuel Friedrich Sauter, erschienen in den Münchner Fliegenden Blättern.
Nach diesem Herrn Biedermaier wird in Wien jene Epoche des Vormärz benannt werden, deren Erkennungsmerkmale spätklassizistische Bauformen, neue Typen von Mietshäusern und Villen, funktionale Industriearchitektur und schlichtes, aber elegantes Möbeldesign sind. Bei genauer Betrachtung erschließt sich im Wiener Biedermeier eine Gesellschaft, die sich durch ausgesprochene Weltoffenheit und Neugierde, durch ein Streben nach Empirie, Erkenntnisgewinn und technischer Erneuerung auszeichnet. Wie konnte eine Epoche, die von Pioniergeist, humanistischen Werten, gesellschaftlichen Errungenschaften und einer neuen Ästhetik getragen ist, zu einem so elenden Image kommen?
Beitrag von Markus Hübl
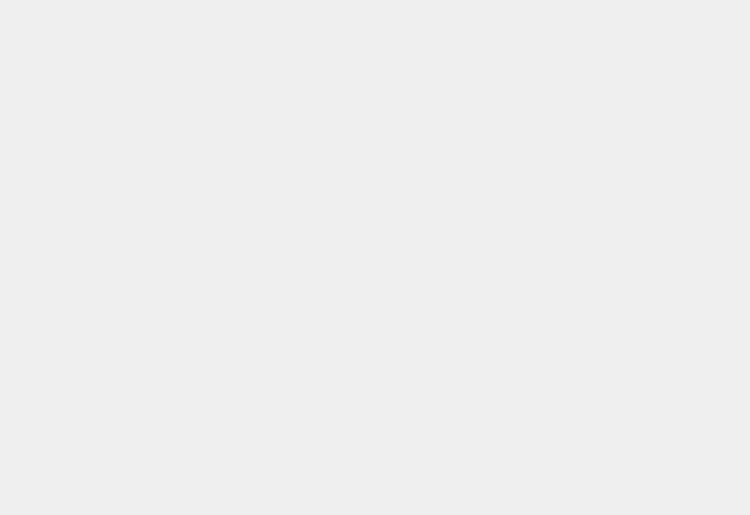 FRIEDRICH VON AMERLING, Bildnis eines Mädchens, 1839 © Leopold Museum, Wien, Schenkung aus Privatbesitz, Foto: Leopold Museum, Wien
FRIEDRICH VON AMERLING, Bildnis eines Mädchens, 1839 © Leopold Museum, Wien, Schenkung aus Privatbesitz, Foto: Leopold Museum, Wien
BIEDERMEIER
Eine Epoche im Aufbruch
10.04.2025–27.07.2025
Die faszinierende Epoche des Biedermeier erstreckte sich in etwa vom Wiener Kongress 1814/15 bis zum Revolutionsjahr 1848. Mit rund 190 Werken präsentiert die Ausstellung – von Gemälden und Grafiken bis hin zu Möbeln, Glaswaren und Kleidern – ein vielfältiges Bild dieser Epoche. Im Fokus steht dabei nicht nur Wien als Zentrum der Habsburgermonarchie, sondern auch die prachtvollen Städte der damaligen Kronländer – Budapest, Prag, Ljubljana, Triest, Venedig und Mailand – und deren künstlerische und kulturelle Entwicklungen.