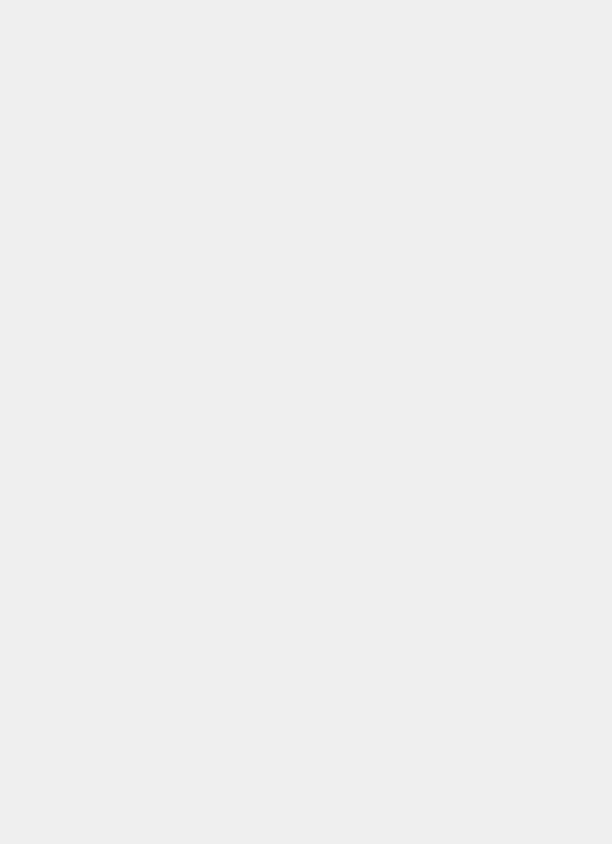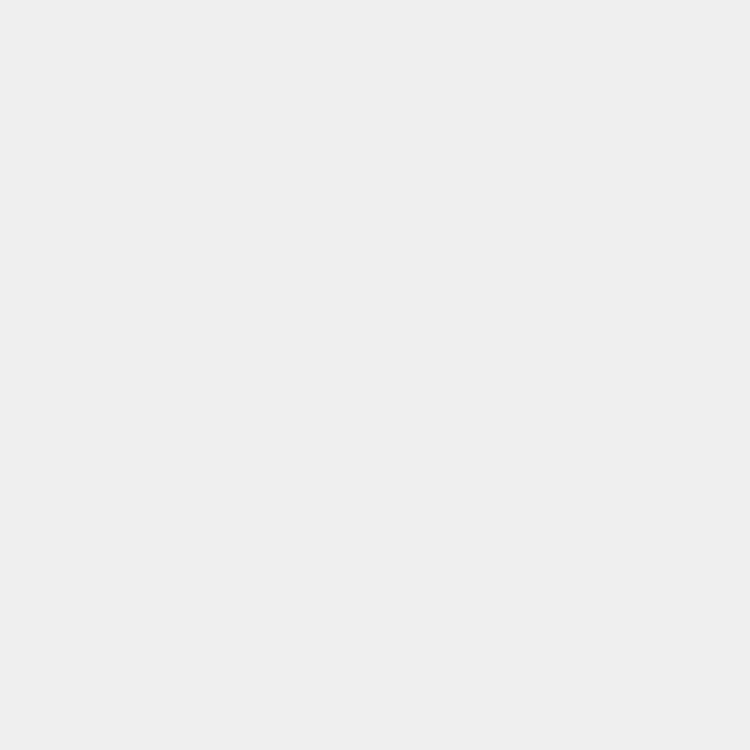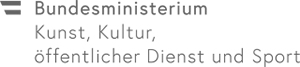FERDINAND HODLER, Blick ins Unendliche III (Detail), 1903/04 © Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Erworben 1994 | Foto: Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne
04.09.2025–18.01.2026
VERBORGENE
MODERNE
FASZINATION DES OKKULTEN UM 1900
„Ich verstehe unter occulten Vorgängen alle jene von der offiziellen Wissenschaft noch nicht allgemein anerkannten Erscheinungen des Natur- und Seelenlebens, deren Ursachen den Sinnen verborgene, occulte, sind […].“
Carl Kiesewetter, Geschichte des neueren Occultismus, 1891
Verborgene Moderne. Faszination des Okkulten um 1900
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wuchs das Bedürfnis nach einer spirituellen Erneuerung. Um göttliche Weisheit zu finden, widmeten sich Okkultist*innen dem Studium altindischer und gnostischer Schriften – auch in Wien. Als neue Denkfabriken fungierten theosophische Workshops auf dem Cobenzl und vegetarische Mittagstische in der Innerstadt. In den Séancen suchte man nach der vierten Dimension. Von dem esoterischen Glauben an unsichtbare Strahlen und feinstoffliche Existenzformen bleiben auch viele Künstler*innen nicht unberührt: Ihre Röntgenblicke drangen bis zu den Knochen und ließen menschliche Körper auratisch leuchten.
Lebensreformer*innen schlossen sich in vegetarischen Siedlungen zusammen. Die Kleiderreform empfahl das Tragen leichter Kittel: Weg mit Korsett und Frack! Man lehnte die Pockenimpfung ab und zog gegen medizinische Tierexperimente zu Felde. Der bayerische Maler und Freiheitsapostel Karl Wilhelm Diefenbach (1851–1913) gründete am Rande Wiens eine der ersten Landkommunen Europas. Seine Erkennungsmerkmale: langes Haar, Prophetenbart, ungefärbte Wollkutten und Sandalen.
Die Ausstellung präsentiert im Überblick eine Vielzahl von Bewegungen, die eines gemeinsam hatten: die Kritik an der Industrialisierung, an der autoritären Gesellschaft und an der Religion des Geldes. Vegetarier*innen, Buddhist*innen und mit Spiritismus experimentierende Mathematiker einigten sich auf das Feindbild „Materialismus“, das sie mit einer Aufwertung des Geistigen bekämpfen oder zumindest ergänzen wollten. Zugänge zu okkulten Wahrheiten waren dabei unterschiedlich: Es konnte das wissenschaftliche Labor sein, die heilsame Natur oder die Lektüre des spirituellen Lehrgedichts „Bhagavad Gita“. Die angestrebte „Höherentwicklung der Menschheit“ hatte eine innere Reform des Einzelnen zur Voraussetzung; es galt, die verlorene Balance zwischen Körper, Geist und Seele wiederzuerlangen.
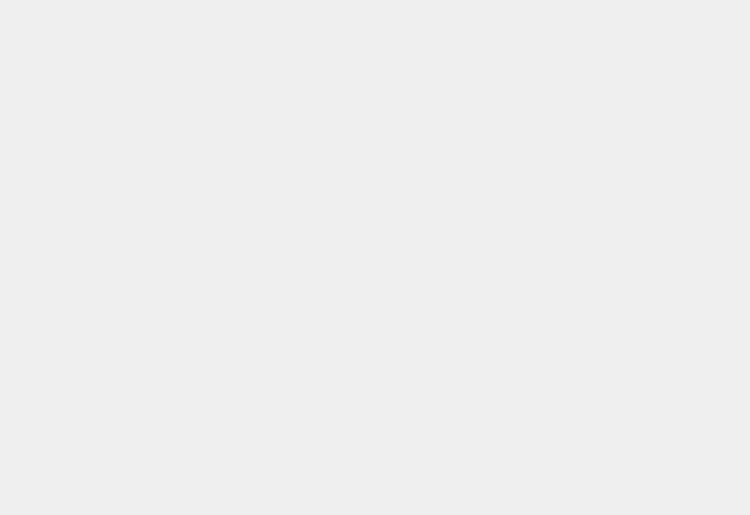 ALBERT VON KELLER, Spiritistischer Apport eines Bracelets, 1887 © Kunsthaus Zürich, Geschenk aus dem Nachlass Dr. Oskar A. Müller, 2007 | Foto: Kunsthaus Zürich
ALBERT VON KELLER, Spiritistischer Apport eines Bracelets, 1887 © Kunsthaus Zürich, Geschenk aus dem Nachlass Dr. Oskar A. Müller, 2007 | Foto: Kunsthaus Zürich
Der Münchner Starmaler Albert von Keller (1844–1920) wohnte in den 1880er-Jahren spiritistischen Séancen bei und veranstaltete solche sogar in seinem Haus. Einschlägige Motive hielt er gerne fotografisch fest und setzte sie anschließend malerisch um, so auch in diesem Fall. Mit theatralischer Geste begleitet die Bildprotagonistin den sogenannten „Apport“ – die Materialisierung eines Gegenstandes, den sie auf unsichtbarem Wege von seinem Ursprungsort herbeigeholt haben soll. Mehrfach als „somnambul“ abgelichtet, bietet sie ein Paradebeispiel für jene Frauen, die in medizinischen Kontexten als „hysterisch“, in spiritistischen Salons hingegen als „übernatürlich begabt“ in Szene gesetzt wurden.
Der Rundgang durch die Schau beginnt in der Zeit des Historismus und mit der Suche des Komponisten Richard Wagner nach künstlerischen Antworten auf metaphysische Fragen. Wagners Musik versetzte die Jugend in Trance, seine Gedanken zum Tierschutz lösten eine vegetarische Welle aus. Der Philosoph Friedrich Nietzsche war ein weiterer Held der Epoche. Er verspottete die von den traditionellen Religionen angebotenen metaphysischen Tröstungen. Seine Lehre einer radikalen Diesseitigkeit leitete jene an, die durch Turnen, Fasten und Meditieren über sich hinauswachsen wollten.
Ein weiteres Kapitel gibt einen Überblick über die okkult-reformerischen Zirkel in Wien. Die Aktivistin Marie Lang (1858–1934) verband theosophische Ideen mit feministischem Engagement. Am anderen Ende des politischen Spektrums stand Jörg Lanz von Liebenfels (1874–1954), der seine antisemitischen und sozialdarwinistischen Ideen zur „Ariosophie“ bündelte und einen rechtsextremen Männerorden gründete. Hier zeigt sich die präfaschistische Seite einer Ideologie, die zwischen „minderwertigen“ und „auserwählten“ Menschen unterschied. Okkulte Vorstellungen eines „entarteten“ oder „höheren“ Lebens flossen in den Rassenwahn des Nationalsozialismus ein.
Das Kapitel über den Spiritismus stellt eine Mode vor, die aus den USA kam und in mehreren Phasen nach Österreich schwappte. Zumeist weibliche Medien versprachen, mit Stimmen im Jenseits in Verbindung zu treten. Im Spiritismus flossen alle Aspekte des Okkultismus zusammen: der Glaube an eine andere Wirklichkeit, das parawissenschaftliche Interesse an unerforschten Phänomenen und das unterhaltsame Gruseln beim Tischlrücken. Künstler wie der Münchner Starmaler Albert von Keller (1844–1920) veranstalteten Séancen und porträtierten Medien. In diesem Abschnitt sind auch die außergewöhnlichen Zeichnungen der Wiener Künstlerin Gertrude Honzatko-Mediz (1893–1975) zu sehen, die nach Anweisungen von Verstorbenen entstanden.
Beispiele von František Kupka, Wassily Kandinsky und Johannes Itten dokumentieren den enormen Einfluss okkultistischer Lehren auf die Entwicklung abstrakter Malerei. Oskar Kokoschka interessierte sich in seinen Porträts für Nervengeflechte, die im Okkultismus als wichtige Organe galten. Nervenbahnen dienten, so die Lehre, der Übertragung von Schwingungen in den Äther.
Der am Spiritismus interessierte Maler František Kupka (1871–1957) las esoterische Schriften und blieb Zeit seines Lebens ein reformerischer Geist. Sein kleinformatiges Ölgemälde Le Rêve veranschaulicht in seltener Eindringlichkeit den theosophischen Glauben an die Existenz eines Astralleibes, welcher sich im Traum – wie auch im Tod – vom physischen Körper löst. Von einer Lichtflut getragen, vollziehen die beiden Astralleiber ihre Vereinigung. Die Dynamik dieses Wandels findet ihr Echo in jener der übereinander geschichteten Raumflächen rechts im Bild – wohl eine Folge von Kupkas Interesse an chronofotografischen Effekten.
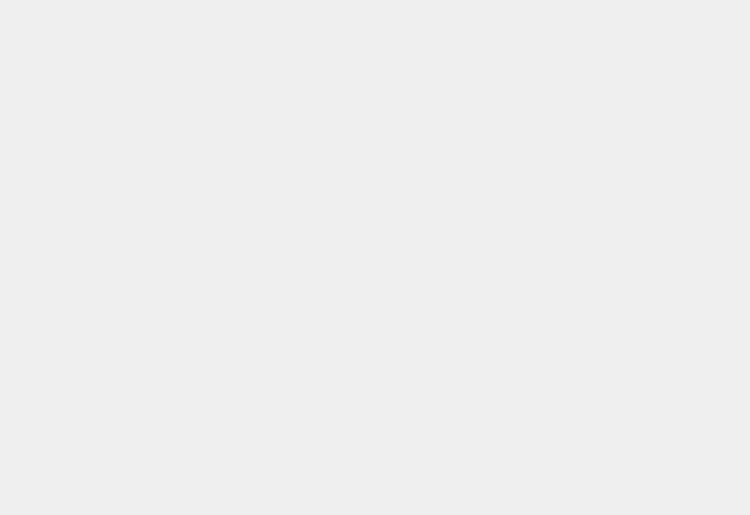 FRANTIŠEK KUPKA, Le Rêve, um 1909 © Sammlung Kunstmuseum Bochum | Foto: Presseamt Stadt Bochum/Lutz Leitmann, Bildrecht, Wien 2025
FRANTIŠEK KUPKA, Le Rêve, um 1909 © Sammlung Kunstmuseum Bochum | Foto: Presseamt Stadt Bochum/Lutz Leitmann, Bildrecht, Wien 2025
Das Finale der Verborgenen Moderne widmet sich der Lebensreform, der praktischen Seite des Kampfes gegen den Materialismus. Hier zeigt sich der kritische Zeitgeist in seiner ganzen Vielfalt. Ein Hotel in Baden bei Wien stellte Turngeräte der Marke Zander zur Verfügung, die sich aus der Zeit von Kaiserin Elisabeth erhalten haben; Sisi stählte ihren Körper mit Zander-Apparaten. Das Bergsteigen, dem die Kaiserin ebenfalls frönte, entwickelte sich zur Königsdisziplin des „neuen Menschen“. Der Alpinismus verband stoische Philosophie mit Fitness, Selbstoptimierung mit neuen Sportartikelmarken. Ein abschließender Ausblick auf die Tanzmoderne führt in die 1920er-Jahre, als die Erste Republik unbekannte Freiheiten in Aussicht stellte. Tänzerinnen und Choreographinnen wie Susanne Schmida (1894–1981) entwickelten aus Yoga, Gymnastik und der Nietzsche-Rezeption Bewegungen zu einer ganzheitlichen Lebensform.
Kuratoren: Matthias Dusini, Ivan Ristić
JETZT TICKETS SICHERN!
Gezeigt werden unter anderem Werke von:
MARIA CYRENIUS, KARL WILHELM DIEFENBACH, RICHARD GERSTL, GUSTO GRÄSER, FERDINAND HODLER, HUGO HÖPPENER (FIDUS), JOHANNES ITTEN, WASSILY KANDINSKY, ALBERT VON KELLER, FERNAND KHNOPFF, ERIKA GIOVANNA KLIEN, OSKAR KOKOSCHKA, FRANTIŠEK KUPKA, GABRIEL VON MAX, KOLOMAN MOSER, EDVARD MUNCH, MAX OPPENHEIMER, EGON SCHIELE, ARNOLD SCHÖNBERG, AUGUST STRINDBERG, GERTRAUD REINBERGER-BRAUSEWETTER UND MY ULLMANN.
"Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt denen nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen reden!"
Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, 1883
ERICH MALLINA, Engelszug, 1904 © Dauerleihgabe UniCredit Bank Austria AG in der Kunstsammlung und Archiv, Universität für angewandte Kunst Wien | Foto: kunst-dokumentations.com/Manuel Carreon Lopez © Nachlass Erich Mallina