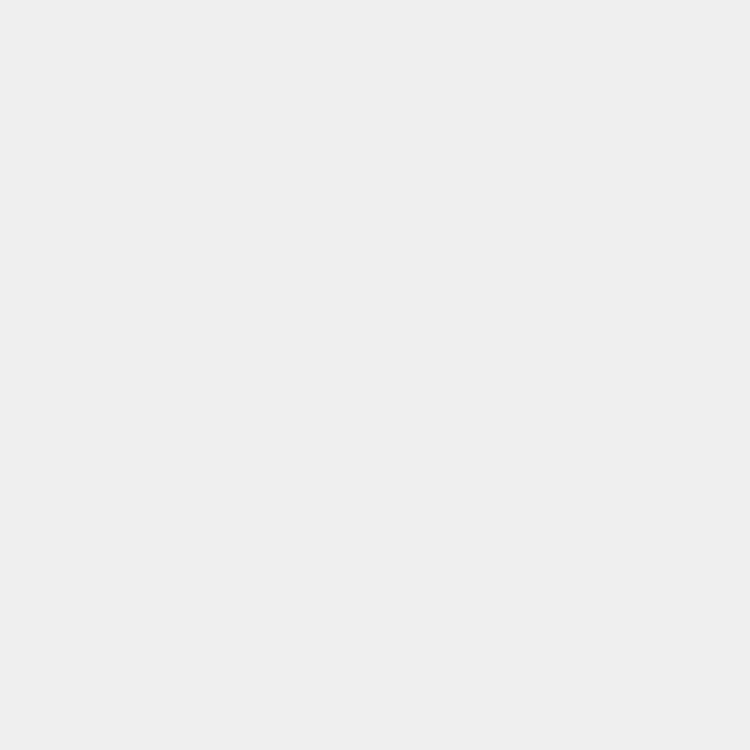FRIEDRICH VON AMERLING, Bildnis eines Mädchens, 1839 © Leopold Museum, Wien, Schenkung aus Privatbesitz, Foto: Leopold Museum, Wien
Wiener Geschichten – Leopold Museum Blog
ROLLENBILDER
FRAU SEIN IN WIEN UM 1900
Ebenholzschwarzes, blumengeschmücktes Haar umrahmt den hellen Teint. Die kindlich gerundeten Wangen sind von zarter Röte überzogen. Der seitwärtsgewandte Blick des jungen Mädchens strahlt liebreizende Sanftmut aus. Versonnen spielt die kleine Hand mit dem aus der züchtigen Frisur fallenden matt rosa glänzenden Seidenbändchen. Die rundlich abfallenden Schultern werden von einer duftig weichen Pelzverbrämung umwölkt. Ein fast unmerklicher Hauch von Erotik umspielt dieses kindliche Antlitz mit seinen großen Augen und dem stumpfen Näschen. Friedrich von Amerling betont die makellose Haut der Femme fragile, der Kindfrau, und setzt mit dem Mädchenporträt ein nachwirkendes Ideal: Zwischen willenloser Naivität und betörender Sinnlichkeit zieht das junge Wesen die Blicke auf sich – einerseits als Paradebeispiel eines züchtigen, den biedermeierlichen Konventionen entsprechenden Wesens, andererseits als Projektionsfläche männlicher Begierden und Bedürfnisse.
Der Spätklassizismus gibt sich noch lange nicht geschlagen. Damen der Gesellschaft lassen sich knapp sechzig Jahre später von Malerfürsten wie Hans Makart in ähnlicher Weise inszenieren: Theodora von Gözsy beweist in ihrer jungmädchenhaften Pose gleichzeitig das Selbstbewusstsein einer Vertreterin der aufstrebenden Wiener Bourgeoisie. Aus dem Dunkel eines wertig eingerichteten Salons blitzt die Noblesse der Großbürgerin mit Hochsteckfrisur in knisternder schwarzer Seide und mit ideal geschnürter Taille hervor.
Kraftvoll angespannt sitzt der nackte Leib der Amazone auf dem Rücken des vorwärts stiebenden Pferdes. Gleichsam Herrin über Leben und Tod, hält sie den Speer im Anschlag. Mit dieser Arbeit schafft Franz von Stuck einen Archetyp der Femme fatale, freilich nicht ohne die weibliche Sinnlichkeit ironisierend zuzuspitzen. Fast zeitgleich gehen jedoch kritische Künstlerinnen ganz andere Wege.
In unnachahmlicher Lakonik zeigt Broncia Koller-Pinell den Körper ihres Aktmodells Marietta. Der unverwandte Blick der Frau im Bild hält jenem ihres Gegenübers unaufgeregt stand. Selten ist die weibliche Nacktheit so selbstbewusst und entspannt gezeigt worden. Kein Anflug von Laszivität – es ist, was es ist: Der sitzende Körper einer Frau, die gezwungen ist, ihren Unterhalt mit der Zurschaustellung ihres entblößten Körpers zu verdienen. Das leicht gesenkte Haupt Mariettas ist vor einer quadratischen Gloriole positioniert – eine geradezu paradox anmutende Sakralisierung angesichts der Forderungen der Ersten Frauenbewegung. Die Frauenrechtlerin, Sozialarbeiterin und Salonière Marie Lang kämpft gemeinsam mit anderen herausragenden Persönlichkeiten wie Auguste Fickert, Marianne Hainisch und Rosa Mayreder für Grundrechte. Es sind Frauen, die ihre Anliegen klar formulieren und für eine Veränderung der gesellschaftlichen Machtverhältnisse eintreten.
Marie Lang setzt sich für Mutterschutz und die Rechte unehelicher Kinder ein. Und sie tritt gegen die Reglementierung der Prostitution auf. Außerdem kämpft sie für die Aufhebung des „Lehrerinnenzölibats“ – jener Regelung, aufgrund derer eine Lehrerin im Fall einer Eheschließung gekündigt wird und den Anspruch auf Ruhegeld verliert. Mayreder kritisiert bereits sehr früh in ihren philosophischen und sozialwissenschaftlichen Schriften die traditionellen Rollenbilder und die Degradierung der Frauen zu Sexualobjekten.
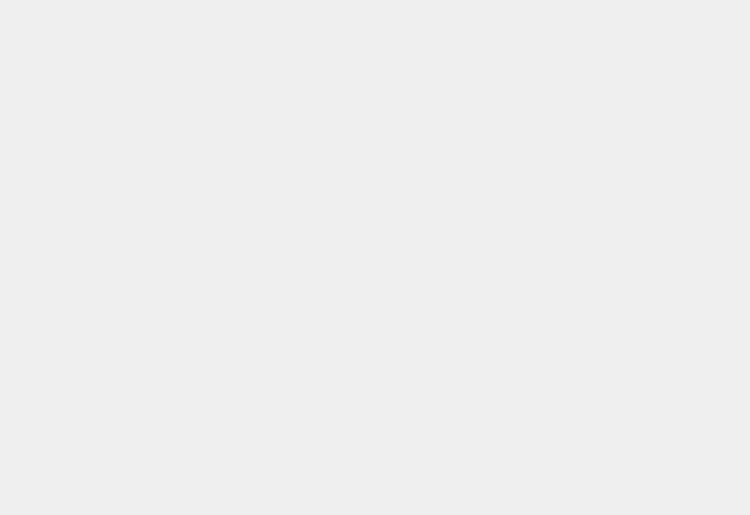 ERWIN LANG, Grete Wiesenthal in Landschaft, undatiert © Familie Konrad Lang in Altmünster
ERWIN LANG, Grete Wiesenthal in Landschaft, undatiert © Familie Konrad Lang in Altmünster
In Marie Langs Salon hat die aus einer assimilierten jüdischen Familie stammende Broncia Pinell ihren späteren Ehemann kennengelernt, den Industriellen und Kunstmäzen Hugo Koller. Ihr eigener Salon wird zu einem jener Brennpunkte des geistigen Lebens, das von einem liberalen Weltverständnis geprägt ist. Marie Langs Sohn, der Maler und Grafiker Erwin Lang, schafft Plakate und Inszenierungen für seine Frau Grete Wiesenthal, einer Vertreterin des modernen Tanzes in Wien.
Mit psychologisch-sezierendem Blick legt Max Oppenheimer Facetten einer Persönlichkeit frei, die für ihren Furor, ihre überbordende Bühnenpräsenz, ihr fulminantes dramatisches Talent und ihr politisches Engagement bekannt ist. Die aus dem neunten Wiener Bezirk stammende Schauspielerin Tilla Durieux ist in Berlin ein Star. Ihre Interpretationen starker, verführerischer Frauenfiguren wie Salome oder Circe sind gleichermaßen von prickelnder Erotik und psychologischer Tiefe getragen. Oppenheimer zeigt jedoch die Frau des Galeristen Paul Cassirer als eine Suchende, Sinnierende, Durchlässige – als Menschendarstellerin, die in ihrem Ringen um Ausdruck erlebbar wird. Tilla Durieux ist ein Bühnenstar, der in den Parkanlagen von Berlin kostenlos auftritt, um auch denjenigen Kunst näherzubringen, die sich Theaterbesuche nicht leisten können. Die mondäne, elegante, selbstbewusste und obendrein politisch denkende Frau – ein modernes Rollenbild!
Beitrag von Markus Hübl