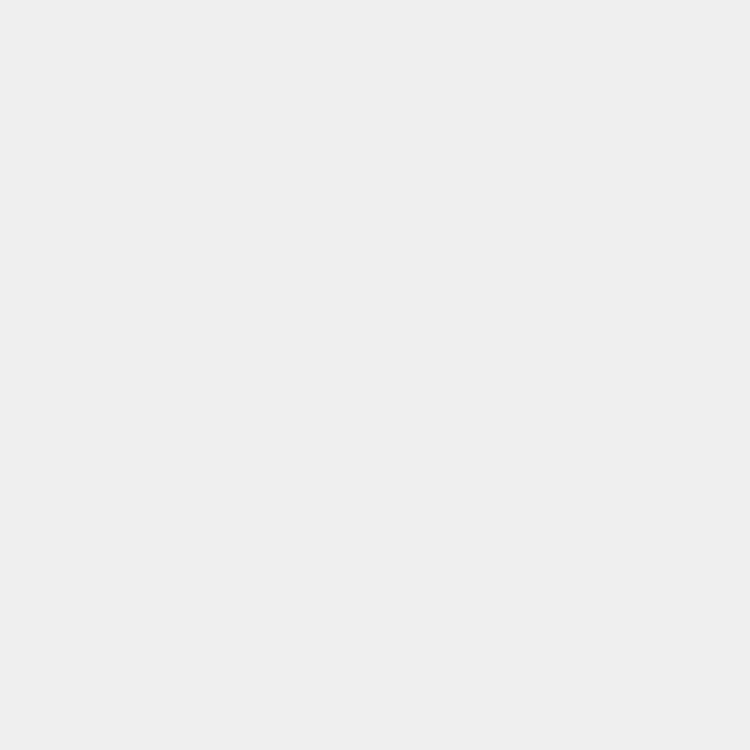Egon Schiele, Versinkende Sonne, 1913 © Leopold Museum, Wien, Inv. 625
Wiener Geschichten
METAPHERN
DES ABSCHIEDS
Leopold Museum Blog
Düster, schief und eingesunken. Wie verschreckte Tiere am schwarzblauen Wasser hockend schmiegen sich die kleinen mittelalterlichen Häuser an das Ufer des dunkel und träge dahinströmenden Flusses. Tote Stadt III benennt Egon Schiele seine Stadtdarstellung. Er ist fasziniert von diesem Titel, den er noch fünf weiteren seiner Werke gibt.
Von Herbststürmen zerzauste Bäume, kraftlos und müde verwelkende Pflanzen, eine versinkende Sonne: In den Landschaften entdeckt Schiele Sinnbilder der Vergänglichkeit.
Magere und hohlwangige Gesichter, gerötete, geschlossene und blinde Augen, grünlich-bläulich-violette Hautoberflächen: Schieles Leiber erscheinen ausgezehrt, vom Tod gezeichnet.
Pastos und in dynamischen Pinselschlägen taucht auch Schieles älterer Malerkollege und Freund Max Oppenheimer die von ihm porträtierten Persönlichkeiten aus der Wiener Kulturszene in einen trüben, verhaltenen, ocker-morastigen Farbkanon. Sich selbst inszeniert er als einen nachdenklichen, nahezu gebrochenen Salvator mundi mit mumienhafter, dürrer Hand vor seiner Brust. Anton Koligs liegender Jüngling, in graue Töne getaucht, nimmt trotz der zur Schau getragenen homoerotischen Neigungen des Malers die Aura eines aufgebahrten Leichnams an. Und der hochtalentierte junge Richard Gerstl lässt seinen entblößten Leib, der lediglich von einem Lendentuch bedeckt ist, vor einer Gloriole im Transzendenten schweben.
Wie ein roter Faden ziehen sich symbolistische Motive des Abschieds und des Todes durch die expressiven Werke dieser jungen, intellektuellen Künstlerpersönlichkeiten. Als Chronisten des Zerfalls machen sie mit seismografischem Blick und sensitiver Treffsicherheit die Stimmung hinter der ökonomischen und gesellschaftspolitischen Realität sicht- und erlebbar.
„Im Grunde glaubt niemand an seinen eigenen Tod oder, was dasselbe ist: Im Unbewussten sei jeder von uns von seiner Unsterblichkeit überzeugt.“
Sigmund Freud: Zeitgemäßes über Krieg und Tod (1915), Frankfurt am Main 2009, S. 149
Wien um 1900. Eine Weltmetropole, die aus den Nähten zu platzen droht. Unter der Oberfläche pulsierender Betriebsamkeit schlummert der morbide Zerfall einer Monarchie, die trotz Modernisierungsbestrebungen in Erstarrung verharrt. Das Habsburgerreich ist vom Untergang bedroht. Hinter der mondänen Fassade der aufgeputzten Hauptstadt schlummern Melancholie und Depression. Längst hat sich die desillusionierende Atmosphäre des Verfalls durch das riesige Kaiserreich diffundierend auch in den kleinen Städten der Provinz breitgemacht. Separationsbestrebungen und politische Diskrepanzen kulminieren. Der Mord am Thronfolgerpaar führt 1914 zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges und zu einer grauenhaften Menschheitskatastrophe. Am 12. November 1918 wird dann Österreich feierlich als „demokratische Republik Deutsch-Österreich“ ausgerufen. Die Donaumonarchie als Vielvölkerstaat ist Geschichte. Weltwirtschaftskrise, Hyperinflation und Massenarbeitslosigkeit – die Spuren der Verwüstung prägen viele Länder Europas. Die Gesellschaften sind leidvoll aufgerieben. Das fruchtbare Substrat der politischen Verwerfungen ist aufbereitet.
In Abkehr vom Expressiven wenden sich Künstler*innen neuen Ausdruckmitteln zu. Unter der stillen Oberfläche der akkurat wiedergegebenen, geglätteten „Dingwelt“ in der Neuen Sachlichkeit verbergen sich neuerlich Symbole des Abschieds, des Absterbens und der Trauer. Rätselhaft und irritierend macht der Bregenzer Maler Rudolf Wacker als einer der wichtigsten Vertreter dieser neuen Kunstrichtung in Österreich Brüche und Ambivalenzen sichtbar: Die Konstellation unterschiedlicher lebloser Objekte bringt eigentümliche Beziehungen zum Vorschein. In Stillleben mit Haubensteißfuß von 1928 wird die sonderbare Inszenierung von einem präparierten Haubentaucher dominiert. Hochgereckt, mit zur Balz aufgefächerter Federhaube steht der bizarre Wasservogel zwischen suggerierter Lebendigkeit und lebloser Erstarrung mit seinen Lappenschwimmfüßen auf ein Stück organisches Material montiert. Im Zusammenführen von täuschend echt dargestellten Objekten entwirft Wacker in einer Zeit politischer Unsicherheit und gesellschaftspolitischer Umbrüche ein psychologisch komplexes Spiel mit Assoziationen und Deutungsmöglichkeiten.
Die stilistischen Mittel haben sich gewandelt. Was inhaltlich-thematisch bleibt, ist die omnipräsente Vorahnung des Todes. Visionär zeichnet auch Wacker das komplexe Bild einer Zeitenwende: Der politische Umsturz in Deutschland und die Wahl Adolf Hitlers zum Reichskanzler 1933 werden neuerlich und mit noch erschreckenderen Folgen einen Prozess der Enthumanisierung in Gang setzen.
Beitrag von Markus Hübl