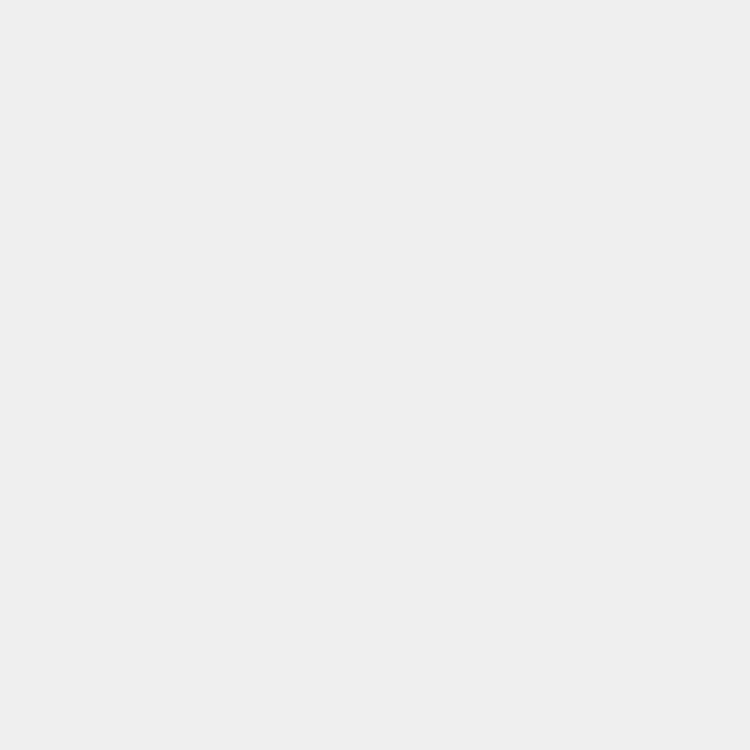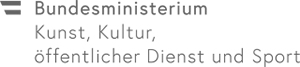FRIEDRICH VON AMERLING, Bildnis eines Mädchens, 1839 © Leopold Museum, Wien, Schenkung aus Privatbesitz, Foto: Leopold Museum, Wien
10.04.–27.07.2025
BIEDERMEIER
Eine Epoche im Aufbruch
BIEDERMEIER
Eine Epoche im Aufbruch
Die faszinierende Epoche des Biedermeier, die sich in etwa vom Wiener Kongress 1814/15 bis zu den Jahren rund um die bürgerliche Revolution von 1848 erstreckte, umreißt eine Zeit, in der Europa von politischen Umwälzungen und sozialen Umbrüchen geprägt war. Das Ergebnis des Kongresses war die Wiederherstellung des Absolutismus, die eine lange Phase der Restauration einleitete und die Unterdrückung demokratischer Bestrebungen zur Grundlage hatte. Aus Angst vor Repressalien wandte sich die Bevölkerung vom politischen Geschehen ab und flüchtete ins Private.
Abseits aller politischen Friktionen war diese Zeit zugleich eine Ära großer Innovationen und ästhetischer Umbrüche. Die wichtigste treibende Kraft war der industrielle Fortschritt: Erste Eisenbahnlinien wurden gebaut, und spektakuläre Hängebrücken entstanden, wie jene zwischen Buda und Pest. Diese technologischen Revolutionen führten nicht zuletzt auch zu einem entscheidenden Wandel in der künstlerischen Entwicklung. Viele Neuerungen gingen dabei nicht von Wien als Zentrum der Habsburgermonarchie aus, sondern von den prachtvollen Städten in den Kronländern – Budapest, Prag, Ljubljana, Triest, Venedig und Mailand.
Der internationale Austausch war prägend für die Künste der Monarchie und so stehen nicht nur die Wiener Meister wie Ferdinand Georg Waldmüller und Friedrich von Amerling im Mittelpunkt, sondern auch Miklós Barabás und József Borsos aus Budapest, Antonín Machek und František Tkadlík aus Prag sowie die in Lombardo-Venetien tätigen Künstler Francesco Hayez und Jožef Tominc (Giuseppe Tominz).
Trotz der bitteren Armut, die weite Bevölkerungsschichten betraf, bildete sich durch den wirtschaftlichen Aufschwung ein Bürgertum heraus, das sich selbstbewusst in seiner Rolle darstellen ließ. Neben Porträts beherrschten Themen des Alltags die Bilderwelt: Familienbilder, das Genre und die Wiedergabe der eigenen Umwelt. Darüber hinaus wurde der Blick – entgegen der üblichen Reduzierung der biedermeierlichen Perspektive auf das Kleine und Naheliegende – auch über die heimischen Gefilde hinaus gerichtet, in ferne Länder oder Städte, wo man die Neugier und das Interesse an anderen Kulturen zu stillen suchte.
Mit rund 190 Werken aus nationalen und internationalen Sammlungen präsentiert die Ausstellung – von Gemälden und Grafiken bis hin zu Möbeln, Glaswaren und Kleidern – ein vielfältiges Bild dieser bedeutenden Epoche.
Kurator: Johann Kräftner
Kuratorische Assistenz und Projektkoordination: Lili-Vienne Debus
Wien und die Hauptstädte des Habsburgerreiches
Wenn auch in der österreichisch-ungarischen Monarchie die Haupt- und Residenzstadt Wien das Zentrum bildete, gewannen die Hauptstädte der Kronländer und des Königreichs Lombardo-Venetien im Biedermeier zunehmend an Bedeutung. Diese Epoche brachte großangelegte urbane Entwicklungen in diesen Städten mit sich. Wiens Expansion waren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die Stadtmauer klare Grenzen gesetzt, welche sich erst durch die Entfestigung 1857 änderten. Doch auch im biedermeierlichen Wien wurden bereits ganze Straßenzüge erneuert oder neu angelegt.
Andere Hauptstädte konnten sich viel freier entfalten. Buda und Pest wuchsen nicht zuletzt durch den Bau der Kettenbrücke zusammen und entlang der Donau wurden ganze Stadtplätze und Straßenzüge mit Zinshausbauten und prachtvollen Palais neu ausgerichtet. Bedeutende Impulse wurden unter der österreichischen Verwaltung auch in den norditalienischen Metropolen gesetzt, es entstanden moderne Theater, Konzerthäuser, Museen, Kaffeehäuser, Schulen, Fabriken und Friedhöfe.
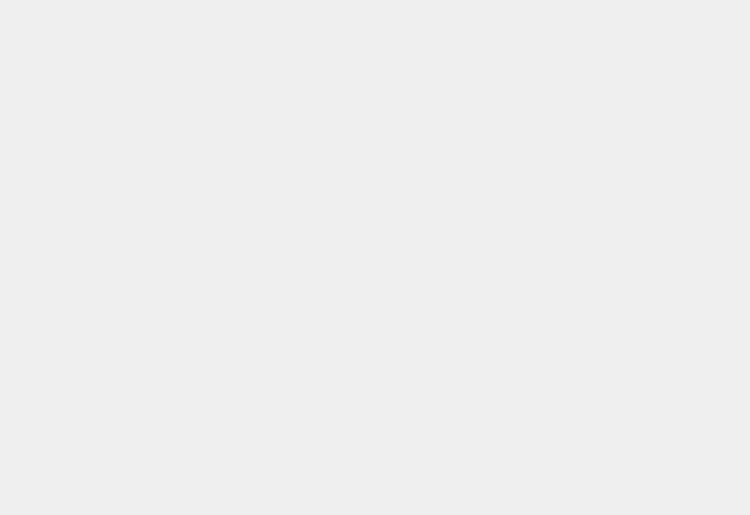 THOMAS ENDER, Das Matterhorn vom Gornergrat gesehen, um 1854 © Museum Georg Schäfer, Schweinfurt | Foto: bpk/Museum Georg Schäfer Schweinfurt
THOMAS ENDER, Das Matterhorn vom Gornergrat gesehen, um 1854 © Museum Georg Schäfer, Schweinfurt | Foto: bpk/Museum Georg Schäfer Schweinfurt
Biedermeierlandschaften
Immer mehr entfernten sich die Maler*innen des Biedermeier von idealen, romantisierenden Landschaftsbildern. Im Zuge ihrer Reisen in das Salzkammergut und in das Voralpengebiet unweit von Wien entstanden detaillierte, realistische Naturdarstellungen. Künstler*innen begleiteten Mitglieder des Hochadels auf Erkundungsfahrten durch österreichische Gebirgslandschaften – oftmals waren sie die Allerersten am Berg.
Nach den Napoleonischen Kriegen blühte der Handel wieder auf, und auch das Reisen wurde erneut zur Möglichkeit, der sich auch die Künstler*innen nicht verschlossen, um Neues kennenzulernen. So rückten ferne Welten in den Fokus des Interesses. Das Skizzieren während dieser Reisen und die Ausführung im Atelier bestimmten den Arbeitsablauf.
Interieur und Mode des Biedermeier
Einen wunderbaren Eindruck der fantasievollen Biedermeiermode gewinnt man anhand von bildlichen Darstellungen sowie der raren und kostbaren Kleidungsstücke der Zeit. Nach 1820 setzen die Biedermeier-Damen auf Rüschen und Taft, starke Farben sowie Korsett und Krinolinen. Durch künstlich erzeugte Wespentaillen und ausladende Röcke ähnelten Frauen mitunter lebendigen Porzellanfiguren.
Innenausstattung und Möbel entwickelten im Biedermeier einen neuen Kanon der Einfachheit, der sowohl vom Bürgertum als auch vom Adel getragen wurde und Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer Wiederentdeckung des Biedermeier durch Architekten wie Adolf Loos und Josef Hoffmann führte.
Frauen und Männer, jung und alt
In der Porträtmalerei wurde das Idealbild immer mehr durch eine möglichst realistische Wiedergabe abgelöst, bisweilen mit beinahe karikaturhaften Zügen. Besonders hervorzuheben sind die Porträts des italienisch-slowenischen Künstlers Jožef Tominc (Giuseppe Tominz), der in der ungeschönten Wiedergabe seiner Modelle brillierte.
Der Familie als Rückzugsort vor den Übergriffen staatlicher Zensur und Bespitzelung kam eine bedeutende Rolle zu. Die eigene Familie im Bild festzuhalten, wurde vor allem in höheren Gesellschaftskreisen Mode. Gesellschaftliche Position und Wohlstand werden in den Bildern durch kostbare Textilien oder das Ambiente unterstrichen. Im Genre hingegen wird die Familienidylle zum Idealbild stilisiert.
JOŽEF TOMINC (GIUSEPPE TOMINZ), Selbstporträt am Fenster (Detail), 1826 © Narodna galerija, Ljubljana, Foto: Narodna galerija, Ljubljana/Janko Dermastja
Alltagsgeschichten, in Szene gesetzt
Darstellungen von Szenen aus dem Alltag und Begebenheiten aus dem Leben der Bäuerinnen, Bauern und Handwerker*innen erfreuten sich großer Beliebtheit. Ein Meister der Inszenierung von Alltagsgeschichten war Ferdinand Georg Waldmüller, in dessen Gemälden sich die Überhöhung und Verschönerung des Alltäglichen mit einer naturalistischen Darstellungsweise paart. Die Betrachter*innen fanden in diesen Werken ein optimistisches Lebensgefühl. Die Epoche brachte für die bürgerliche Oberschicht großen, bisweilen flüchtigen Reichtum. Gleichzeitig lebten bestimmte Bevölkerungsschichten in bitterer Armut. Künstler*innen des Biedermeier wie Josef Danhauser beleuchteten dies sozialkritisch, teils mit bitterer Ironie.
Dieses von Kaiserin Carolina Augusta in Auftrag gegebene Aquarell wurde nur wenige Monate vor dem Tod des Monarchen fertiggestellt. Die Zusammenkunft von 37 Familienmitgliedern fand am 21. Oktober 1834 in der Wiener Hofburg statt. Peter Fendi hatte Gelegenheit, am Tag des Zusammentreffens das Gesamtbild festzuhalten und am nächsten Tag Porträtskizzen von den einzelnen Personen anzufertigen.
Aufgabe dieses Porträts war nicht mehr das repräsentative Herrscherbildnis, sondern das Zusammentreffen einer in Achtung und Zuneigung miteinander verbundenen Familie in einem fast bürgerlich-moderaten Ambiente festzuhalten und als Parabel für das friedliche Zusammenwirken der Völkerfamilie des Habsburgerreiches in meist kolorierten Kupferstichen an die Öffentlichkeit zu tragen.
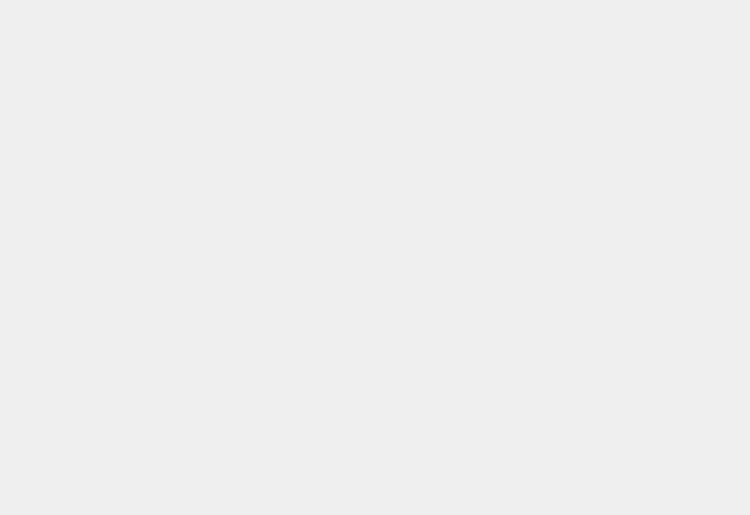 PETER FENDI, Die Familienversammlung des österreichischen Kaiserhauses im Herbst 1834, 1835 © Schloss Artstetten, Foto: Atelier Kräftner
PETER FENDI, Die Familienversammlung des österreichischen Kaiserhauses im Herbst 1834, 1835 © Schloss Artstetten, Foto: Atelier Kräftner